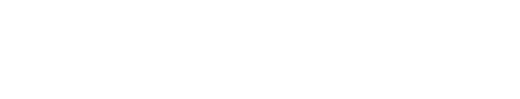1.700 Jahre Konzil von Nizäa und Gedenktag des Konzilsteilnehmers Athanasius
Ein Gastbeitrag von Dr. Gabriele Ziegler
Athanasius (gest. 373), dessen Gedenktag der 2. Mai ist, war als junger Diakon mit seinem alexandrinischen Bischof beim Konzil von Nizäa. Zeitweise lebte er bei den Mönchen in Ägypten und schrieb die Biographie des Antonius (251-356), der „Vater der Mönche“ genannt wurde. In Kap. 69 der Vita heißt es: „Gerufen von allen Brüdern und den Bischöfen, kam Antonius nach Alexandria.“ Was wollte der Mönch in der Großstadt? „Er lehrte das Volk, dass Christus, der Sohn Gottes, nicht ein Geschöpf ist und nicht aus dem Nichts entstanden ist.“
Wurde Christus von Gott Vater wie ein Geschöpf gemacht?
Laut Athanasius positioniert sich Antonius in dem Streit, der die christliche Kirche im 4. Jahrhundert zusätzlich zu Kriegen und der Verfolgung unter Diokletian erschütterte: Wie war zu verstehen, dass Jesus Christus, der als Mensch geboren wurde, schon immer Gott war? Arius, Presbyter in Alexandria, konnte mit seiner Vernunft nicht fassen, wie drei gleich eins sein sollten, wie Vater, Sohn und Hl. Geist ein einziger Gott sein sollten. Er folgerte: Jesus Christus ist ein Geschöpf seines Vaters, ist nicht Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit wie der Vater: „Es war einmal, da war er nicht,“ sagte Arius von Christus. Menschlich gesehen ist das Denken des Arius logisch: Wir können ja nur in unseren Vorstellungen von Gott sprechen. Wenn wir sagen, dass jemand der „Sohn“ von jemandem ist, ist klar, dass der Sohn nicht vor dem Vater gelebt hat und dass der Sohn dem Vater nachgeordnet ist.
Antonius wurde gerufen, um mit seiner Autorität den verunsicherten Christen zu sagen: Der Sohn Gottes ist kein Geschöpf mit einem Anfang in der Zeit wie wir Menschen. Es gibt in der Gottheit keine gestuften Abhängigkeiten. Christus ist Gott, ist das „Wort im Anfang“ (Joh 1,1), ist „Gottes Weisheit und Kraft“ (1Kor 1,24). Natürlich konnte Antonius nicht den Streit in der ganzen Kirche beenden.
Konstantin I., seit dem Jahr 324 Alleinherrscher über den Osten und Westen des Reiches, musste eingreifen. Er bangte für sich selbst und das Reich um den Schutz des Christengottes, den er im Jahr 313 als einzigen Gott anerkannt hatte. So wie es nur einen Gott gab, konnte es auch nur eine richtige Verehrung dieses Gottes geben, und das hieß: Ein richtiges Glaubensbekenntnis. Zwietracht betrachtete er als tödliche Wunde für das Reich. Als Kaiser war Konstantin die einzige letzte Rechts- und Entscheidungsinstanz. So beruft er für Mai 325 ein Konzil nach Nizäa, dem heutigen Iznik in der Türkei, ein. Es sollte klären: Wie kann der christliche Glaube an Gott und seinen Sohn Jesus Christus mit menschlichen Worten formuliert werden, die das Geheimnis des Glaubens aussagen? Viele Briefe, Verleumdungen, Anklagen, hitzige Entwürfe für ein Credo machen eine Einigung aber unmöglich. Man missversteht sich, bekämpft sich gegenseitig mit Worten und Gewalt. Laut den Dokumenten greift Konstantin ein und will, dass es im Bekenntnis heißt: „Jesus Christus ist wesenseins mit dem Vater“. Bis heute sagen wir im Credo: Er ist „Gott von Gott“.
.
Athanasius wird vom Konzil geprägt
Das Konzil gibt Athanasius sein Lebensthema. Schon zur Vorbereitung des Konzils hatte er für seinen Bischof eine wichtige Stellungnahme verfasst. Als er selbst Bischof ist, ab dem Jahr 328, kämpft er vehement für das Credo von Nizäa. Im Brief „Über die Beschlüsse der Synode von Nizäa“ begründet er ausführlich, weshalb das Konzil Christus „wesenseins mit dem Vater“ nennt. Mehrmals wird er von seinen Gegnern vertrieben und kommt im Exil im Jahr 335 auch nach Trier. Im Jahr 381, da ist Athanasius schon tot, wird dann in Konstantinopel das sog. Nizäno-Konstantinopolitanum als Credo festgelegt, dessen Formulierungen wesentlich auf Athanasius zurückgehen. Es steht im Gotteslob unter Nr. 586, im Evangelischen Gesangbuch unter der Nr. 904.
Christus ist „Gott von Gott“ und „Mensch geworden für uns“
Im Credo heißt es von Christus: Er ist „Gott von Gott“ und „Licht vom Licht“. Dann steht da, für uns heute schwer verständlich: Er wurde „gezeugt, nicht geschaffen“. Im griechischen Original meint „gezeugt“: „von einunddemselben Stamm“, wobei der „Stamm“ die Gottheit ist. Es entzieht sich menschlicher Erkenntnis, ist „unsagbar und unaussprechlich“, wie das geschah. Christus ist nicht wie die gesamte Schöpfung von Gott aus dem Nichts erschaffen. Er ist „wesenseins“ mit dem Vater. Er ist Gott.
Dann sagt das Credo, was Christus für uns Menschen getan hat. Er hat sein Gottsein nicht wie eine Raubesbeute festgehalten. Er führte als Mensch ein Leben unter Menschen (Phil 2,6-7), eröffnete uns die Zeitenwende hin zum Heil und brachte uns zurück in das Einssein mit Gott. Keine Vernunft kann das fassen. Aber wir können Christus nachfolgen, der sich nicht zu gut war, Mensch zu sein. Dann ist unser Leben wirklich menschlich. Athanasius schreibt, dass Antonius „Gott-tragend“ und „Mensch Gottes“ (vita 14; 70,2) war. Er begegnete anderen helfend, stützend, eindeutig, nicht verurteilend, innerlich orientiert am Evangelium von Jesus Christus. So konnte Antonius von Gott sprechen.
----
Abbildung: Konstantin mit Soldaten und den 318 Konzilsvätern. Inschrift: omnes subscripserunt – alle 318 Väter haben das Dokument unterschrieben. Bibliotheca Capitolare Vercelli. Wikimedia Commons gemeinfrei